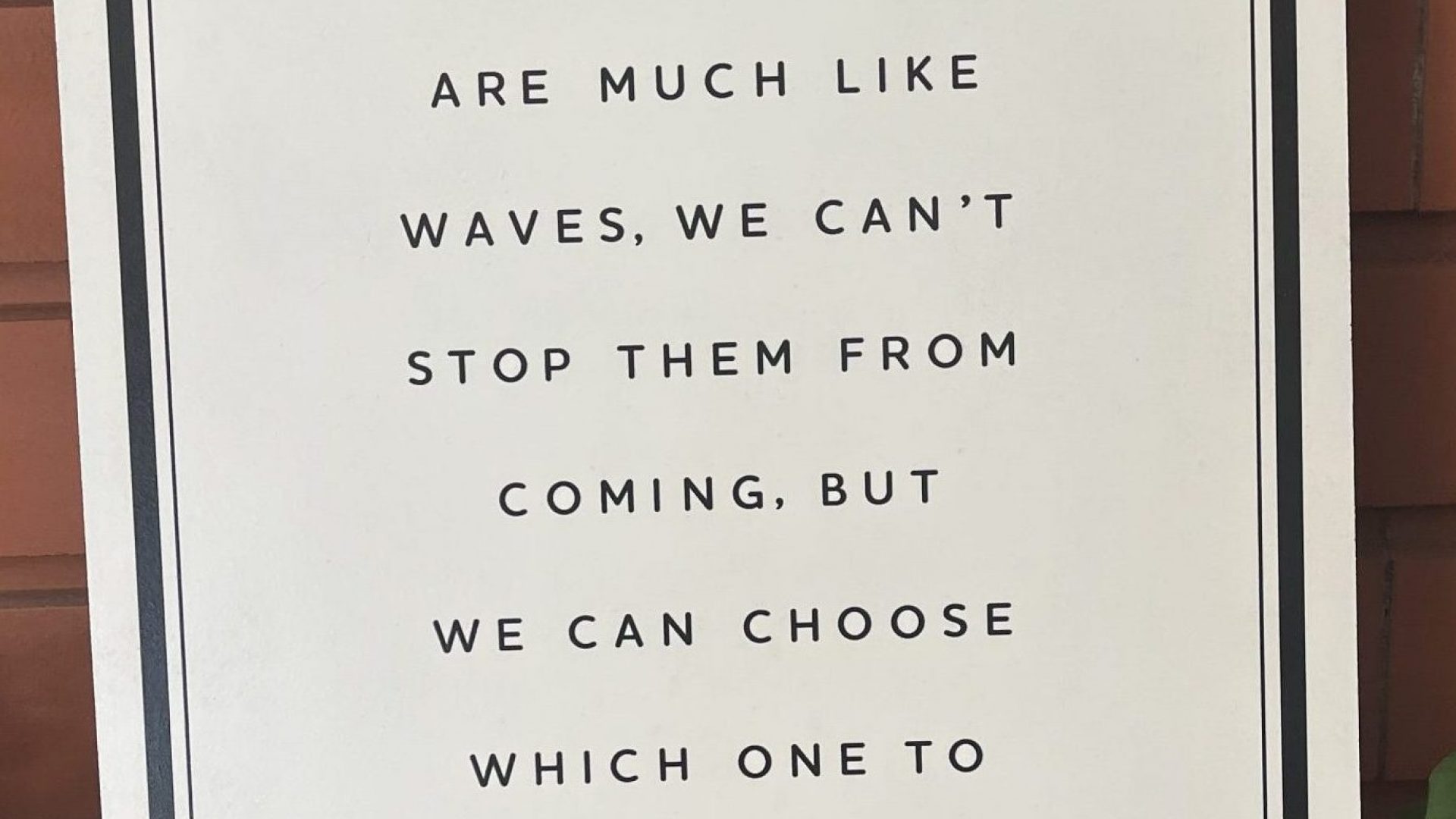Neues und Aktuelles aus der Demenz-Forschung.
1. Plastik im Körper und Gehirn
Die Forschung beachtet mit wachsender Besorgnis die allgegenwärtige Verbreitung von Mikro- und Nanoplastik (MNP) in der Umwelt und deren potenzielle Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit.
In einer Studie wurden neuartige Analysemethoden verwendet, um diese Stoffe in menschlichen Gewebeproben zu identifizieren und zu quantifizieren. Dabei wurde festgestellt, dass sie in verschiedenen Organen vorhanden sind, darunter Leber, Niere und sogar im Gehirn. Besonders bemerkenswert war die Beobachtung, dass das Gehirn im Vergleich zu anderen Organen wie Leber und Niere höhere Konzentrationen von Mikro- und Nanoplatik aufwies. Die Analyse der Proben zigte, dass Polyethylen der am häufigsten vorkommende Kunststofftyp war, begleitet von anderen Polymeren wie Polypropylen, Polyvinylchlorid und Styrol-Butadien-Kautschuk. Eine weitere wichtige Erkenntnis war, dass die Konzentration von MNP im Gehirngewebe im Laufe der Zeit zuzunehmen scheint. Proben aus dem Jahr 2024 zeigten im Vergleich zu Proben aus dem Jahr 2016 einen Anstieg der MNP-Konzentrationen.
Zusätzlich wurde in einer Kohorte von Verstorbenen mit Demenz eine noch höhere Mengen von MNP im Gehirn festgestellt, was auf einen möglichen Zusammenhang zwischen neurodegenerativen Erkrankungen und der Anreicherung von Kunststoffen hindeutet. Die Forscher betonen jedoch, dass es sich hierbei um eine Assoziation handelt und keine Kausalität impliziert.
Die Studien unterstreichen die Notwendigkeit weiterer Forschung, um die Quellen, den Transport, die Aufnahme und die potenziellen gesundheitlichen Folgen von Kunststoffen im menschlichen Gewebe, insbesondere im Gehirn, besser zu verstehen. Die Ergebnisse liefern jedoch bereits ausreichend Argumente für die Entwicklung von Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit und Umweltpolitik, um die Produktion und Entsorgung von Kunststoffen effektiver zu handhaben und die Exposition des Menschen gegenüber diesen allgegenwärtigen Schadstoffen zu verringern.
2. Bluthochdruck und Demenz
Demenz ist weltweit eine der häufigsten Ursachen für Tod und Behinderung und 65% der über 60jährigen Deutschen haben einen Bluthochdruck. Ein Drittel der von Bluthochdruck Betroffenen sind nicht diagnostiziert und die Hälfte der Patienten ist nicht adäquat therapeutisch eingestellt.
In einer Studie untersuchten die Forscher die Wirksamkeit einer Blutdrucksenkung auf das Risiko eine Demenz zu entwickeln bei 33.995 Personen im Alter von ≥40 Jahren mit unkontrolliertem Bluthochdruck. Nach dem Zufallsprinzip wurden 163 Dörfer im ländlichen China einer Intervention zugeführt, die von nicht-ärztlichen Gemeindegesundheitsdienstleistern durchgeführt wurde, und ebenfalls 163 Dörfer der üblichen Blutdruckversorgung zu. In der Interventionsgruppe begannen und passten speziell geschultes Gesundheitspersonal die blutdrucksenkenden Medikamente nach einem einfachen Stufenprotokoll an, um ein systolisches Blutdruckziel von kleiner als 130 mmHg und ein diastolisches Blutdruckziel von kleiner 80 mmHg zu erreichen, wobei sie von Hausärzten überwacht wurden.
Über einen Zeitraum von 48 Monaten betrug die Netto-Reduktion des systolischen Blutdrucks in der Interventionsgruppe im Vergleich zur Standardbehandlung beeindruckende 22 mmHg und die des diastolischen Blutdrucks 9,3 mmHg, also beide deutlich statistisch signifikant. Der primäre Endpunkt der Demenz jeglicher Ursache war in der Interventionsgruppe signifikant niedriger um 15% als in der Kontrollgruppe. Darüber hinaus ergab sich eine 33%ige Reduktion von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Sterblichkeit sowie eine Reduktion um 23% beim Herzinfarkt, 33% beim Schlaganfall, 42% bei Herzinsuffizienz, 30% beim kardiovaskulären Tod und 15% bei der Gesamtmortalität.
Diese Studie zeigt, ähnlich anderen Vorstudien, bemerkenswert, dass eine intensive Blutdrucksenkung sehr wirksam nach bereits kurzer Zeit das Risiko für Demenz jeglicher Ursache bei Patienten mit Bluthochdruck deutlich verringern kann.
3. Hörverlust und Demenz
Die Behandlung von Hörverlust verzögert den kognitiven Abbau bei älteren Erwachsenen mit hohem Risiko. Das präventive Potenzial der Therapie von Hörverlust bei neu auftretender Demenz in einer bevölkerungsbasierten Gruppe älterer Erwachsener und das Potenzial je nach Messmethode des Hörverlusts variiert und ist bisher unbekannt.
Eine prospektive Kohortenstudie war Teil der Atherosclerosis Risk in Communities Neurocognitive Study (ARIC-NCS) und umfasste einen Nachbeobachtungszeitraum von bis zu 8 Jahren (2011-2019). Die vier ARIC-Studienzentren befanden sich in Jackson (Mississippi/USA), Forsyth County (North Carolina), den Vororten von Minneapolis (Minnesota) und Washington County (Maryland). In die Analyse einbezogen wurden zu Hause lebende ältere Erwachsene im Alter von 66 bis 90 Jahren ohne Demenz zu Studienbeginn, die sich bei der sechsten Visite (2016-2017) einer Höruntersuchung unterzogen. Die Datenanalyse erfolgte in 2024. Das zu messende Hauptergebnis war neu auftretende Demenz bzw. der quantifizierte Anteil des Demenzrisikos in der Bevölkerung, der auf einen Hörverlust zurückzuführen ist.
Unter 2946 Teilnehmenden im Durchschnittsalter 74,9 Jahre (59,4% weiblich; Schwarze 21,6% und Weiße 78,4% Personen) hatten 66,1% einen audiometrischen Hörverlust und 37,2% einen selbstberichteten Hörverlust. Der bevölkerungsbezogene attributable Anteil von Demenz bei jeglichem audiometrischen Hörverlust betrug 32%. Die bevölkerungsbezogenen attributablen Anteile waren je nach Schweregrad des Hörverlusts ähnlich (leichter Hörverlust: 16,2%, mittlerer oder schwererer Hörverlust: 16,6%. Selbstberichteter Hörverlust war nicht mit einem erhöhten Demenzrisiko verbunden.
Diese Kohortenstudie legt folglich nahe, dass die Behandlung von Hörverlust Demenz bei einer großen Anzahl älterer Erwachsener klar verzögert. Interventionen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, die auf klinisch signifikanten audiometrischen Hörverlust abzielen, könnten weitreichende Vorteile für die Demenzprävention haben.